Aktualisiert am 15. Oktober 2024.
Im Projekt „AUTwool“ produzieren wir bis November 2024 eine Weste aus Wolle vom Tiroler Bergschaf. Das ist die erste Podcast-Episode einer Serie, mit der wir unsere Weste auf ihrem Weg vom Schaf zum Shop begleiten.
Aus dem „Zukunftsworkshop Schafwolle“, den ich letzten November in der Steiermark organisiert habe (du erinnerst dich an den Bericht?), ist das Projekt AUTwool als Kooperation des Österreichischen Bundesverbandes für Schafe und Ziegen (ÖBSZ) mit mehreren Unternehmerinnen und Gewerbebetrieben entstanden.
Bis November 2024 produzieren wir eine Weste aus Wolle vom Tiroler Bergschaf, die zu 100% in Österreich gewachsen ist und hergestellt wird, bei fairer Entlohnung aller Beteiligten und zu einem vernünftigen Preis.
Im Kernteam des Projektes sind Projektleiter Roland Taferner (ÖBSZ), Designerin Stephanie Höcker (leinup.austria), Hannah Charpin (Kunst am Hof) für die audiovisuelle Begleitung und ich (Gabriele Brandhuber) fürs Marketing.
Filmemacher Walter Aigner (montiola.com) gab eine Finanzspritze zum Start, und bei Künstlerin Gabriele Schuller, der Organisatorin des Textilforum Salzkammergut, werden wir die Jacke im Herbst präsentieren.
Als Partner für die Produktion haben wir fünf etablierte textile Gewerbebetriebe in Tirol, Salzburg und der Steiermark, zwischen denen das Material hin und her transportiert werden wird, bis wir am Ende – im Herbst 2024 – die fertigen Westen an Interessierte verschicken können.

Offiziell heißt unser Projekt AUTwool – gemeinsam Wolle Wert geben.
Seit Januar 2024 trifft sich unser Kernteam zirka alle zwei Wochen. Projektträger ist der ÖBSZ. Wir haben unsere Zielgruppe bestimmt, und die Werte und Ziele des Projekts. Wir haben einen Namen und ein Logo gefunden, den Weg der Wolle bis zum Endprodukt festgelegt, koordiniert und organisiert. Wir haben die Produktionskosten kalkuliert, einen Zeit- und Marketingplan erstellt. Wir waren echt fleissig.
Auf der neuen AUTwool Webseite, die im Juni 2024 online gegangen ist ,und auf Instagram dokumentieren wir die Arbeitsschritte, die beteiligten Betriebe, und legen vor allem unsere Entscheidungen im Design und in jedem einzelnen Produktionsschritt offen. Damit das Produkt am Ende für die Käufer:innen (für uns alle) so transparent wie möglich wird, UND damit nachfolgende Projekte es leichter haben. Nachahmen erwünscht!

In dieser ersten Podcast-Episode in einer Serie, mit der wir unsere Weste auf ihrem Weg vom Schaf zum Shop begleiten, erzählt unser Projektleiter Roland Taferner (Geschäftsführer des ÖBSZ) über Schafe in Österreich, was Bauern und Bäuerinnen schon vor und während der Schur für eine möglichst gute Wollqualität tun können, und wir unterhalten uns darüber, wie dieses Projekt entstand.
- Projektwebseite AUTwool.com
- Podcast: Sammelfolge Konsumdialoge Textilien, 2023
- Bericht vom Zukunftsworkshop regionale Schafwolle in St. Lambrecht
- Projektträger ÖBSZ
- Design der Weste: Stephanie Höcker, Modedesignerin und Landwirtin, intuism.crafts
- Audiovisuelle Begleitung, Hannah Charpin, Medienkünstlerin und Landwirtin, Kunst am Hof
- 00:02:32 Überblick zum Thema Schafe in Österreich: Fleisch, Milch, Landschaftspflege, Wolle
- 00:07:26 800 Tonnen Wolle im Jahr in Österreich: Ein Abfallprodukt?
- 00:15:17 Auslöser für das Projekt: Der Workshop „regionale Wolle“ im November 2023
- 00:19:12 Projekt „AUTwool“ beim ÖBSZ
- 00:21:26 Worauf muss man beim Scheren achten, damit eine gute Wolle herauskommt?
- 00:26:32 Wir nehmen das Bergschaf, weil’s viel davon gibt
- 00:29:00 Schlussworte
Gabi
Hallo lieber Roland. Schön, dass du da bist. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass wir uns eigentlich erst vor zirka einem Jahr, also letzten Juni, bei den Konsumdialogen in Hallein bei Salzburg kennengelernt haben. Da war eine Veranstaltung zum Thema Konsumdialoge Textilien und da warst du auch schon mal in einer Sammelfolge im Podcast zu Gast, den ich über diese Konsumdialoge gemacht habe. Und wer hätte damals gedacht, was wir in diesem Jahr gemeinsam für ein Projekt starten. Dann hast du ja auch noch teilgenommen beim Zukunftsworkshop „Regionale Schafwolle“ in Sankt Lamprecht in der Steiermark im letzten November, aus dem dann unser Projekt entstanden ist, das Projekt AUTwool. Aber da will ich jetzt noch gar nicht so viel verraten, dazu kommen wir dann später. Du bist ja der Geschäftsführer des Österreichischen Bundesverbandes für Schafe und Ziegen. Das ist eine Vereinigung der Züchter und Züchterinnen in Österreich. Gib uns doch bitte mal einen Überblick zum Thema Schafe in Österreich. Also: Wie viele Schafe gibt es? Wo leben die vorwiegend? Wie groß ist das Interesse an Schafen? Und was bewegt Bauern eigentlich dazu, sich Schafe zu halten?
Überblick zum Thema Schafe in Österreich
Roland
Hallo, liebe Gabi. Danke für die Einladung und danke, dass wir uns heute auch wieder unterhalten können über die Schafhaltung und Schafbetriebe in Österreich. Ich finde das einfach großartig, und du hast es schon kurz angeschnitten, wo wir überall schon Schnittmengen gehabt haben, wo wir nicht gedacht hätten, dass wir Schnittmengen haben. Umso spannender macht es das auch. Weil, bevor ich jetzt wirklich auf die Schafhaltung eingehe: Die Schafhaltung in Österreich, ist sehr, sehr vielfältig und divers, und breit aufgestellt. Das macht es auch sehr spannend, aber gleichzeitig herausfordernd. Aber grundsätzlich ist auch die Aufgabe unter anderem des Österreichischen Bundesverbandes für Schafe und Ziegen, die Rahmenbedingungen und Interessen für österreichische Schaf- und Ziegen-Halter:innen gut zu gestalten, mitzugestalten, und auch natürlich zukunftsträchig zu gestalten. Was immer natürlich Herausforderungen mit sich bringt, wenn man denkt, wie unterschiedlich Österreich ist, wenn man von Vorarlberg bis Burgenland denkt. So auch die Schafhaltung. Wir haben in Österreich zirka ein bisschen mehr als 400.000 Schafe. Die Anzahl ist relativ stabil, bis ein bisschen steigend, was natürlich erfreulich ist. Und wir haben zirka 16.000 schafhaltende Betriebe. Das heißt, auf 16.000 Betrieben werden eben diese 400.000 Schafe gehalten, in unterschiedlichsten Formen: im Vollerwerb, in der Professionalisierung, also wenn wirklich nur von der Haltung von Schafen gelebt wird. Aber auch im Nebenerwerb, und dann auch noch im Hobbybereich, wo wir auch sehr viele Halterinnen und Halter haben, die zum Beispiel weniger als zehn Tiere halten. Das gibt es bei uns natürlich auch.
Wichtig ist aber dazu zu sagen: Der Fokus liegt auch für uns in der Haltung, aber auch in der Zucht, natürlich auch in der Produktion. Und vorwiegend ist das die Fleischproduktion. In erster Linie das Lammfleisch oder auch dann das Schaffleisch, die Milchproduktion, also Milchwirtschaft, also Herstellung von der weißen Palette. Das nennt man von Milch bis Joghurt, Käse.
Gabi
„Weiße Palette“ habe ich noch nie gehört.
Roland
Man sagt das immer zusammenfassend. Also alles, was weiß ist, was ich von der Milch herstellen kann, ist diese „weiße Palette“. Und da sind wir auch vom „Gupferl“ bis zum Aufstrich, bis zum Topfen, aber auch bis zu einem wirklichen Hartkäse im Schafbereich überall mit dabei. Ein wichtiger dritter Punkt, bevor ich eigentlich auf den Punkt hinaus will, warum wir uns unterhalten, ist die Landschaftspflege. Es wird sehr, sehr unterschätzt, was die Schafe in Österreich eigentlich für einen Mehrwert für unsere Kulturlandschaft geben und bieten, die Landschaftspflege. Man kann sich das nur vorstellen, was so eine Schafherde über die Sommermonate, vor allem im Weidebereich, abgrast und freihält von Verbuschung oder auch vom Zuwachsen von Flächen, die sonst nicht bewirtschaftet werden würde. Was das bedeuten würde, wenn man das mit menschlicher Arbeit tun müsste. Also sagen wir das Gras mähen, wegbringen, freihalten. Ich glaube, dir geht es auch so: Wenn du nach Österreich schaust, siehst du eigentlich eine offene Landschaft und nicht nur Verbuschung und Wälder, sondern dieses Weite. Das Weite ist eine Charakteristik bei uns.
Gabi
Du sag einmal: Inwiefern betrifft das eigentlich die Almen? Weil für mich sind … Wenn ich so durch Österreich fahre und ich komme aus dem Land Salzburg, da bin ich aufgewachsen. Da sind hauptsächlich Kühe auf den Wiesen und auch auf den Almen. Und jetzt gibt es aber Gebiete oder Bereiche auf den Almen oder in den Bergen, wo die Kühe ja gar nicht unbedingt mehr hin können. Wird das dann von Schafen [beweidet?] … Also: Wo sind überall Schafe? Sind die jetzt hauptsächlich auf den Bergen? Das wäre so mein Eindruck, oder mein Vorurteil. Oder wo in Österreich leben diese Schafe? Überall?
Roland
Ja, also grundsätzlich gehalten werden können Schafe genauso dort, wo auch Rinder gehalten werden können, weil sie auch Wiederkäuer sind und dieses Gras in ein hochwertiges Produkt umwandeln, was ja sonst keine Spezies kann. Also zu finden sind sie schon auch überall. Aber halt speziell in Regionen, wo zum Beispiel ein Rind aufgrund der Größe und auch Habitus nicht mehr hinkommt. Da sagen wir jetzt vor allem Hochalmen, also über 2000, 3000 Metern, wo auch das Gelände nicht mehr so gängig ist. Da sind die großen Schafherden beheimatet, wenn man jetzt zum Beispiel das Tiroler Bergschaf hernimmt. Aber auch in Tälern und an Hängen, wo der Neigungswinkel einfach schon zu groß ist. Also sagen wir: steile Schipisten, steile Obstgärten, steile Weingärten zum Beispiel, aber auch einfach so Flächen, die man nicht würde bewirtschaften können, wenn man die kleinen Wiederkäuer nicht hätte, also das Schaf und die Ziege. Aber ja, man sieht natürlich, wenn man durch Österreich fährt, mehr Rinder. Ist aber auch dadurch bedingt, dass es natürlich auch sehr, sehr viel mehr Rinder gibt. Das muss man auch dazusagen, im Verhältnis dazu. Aber wenn man genauer schaut, findet man sie noch wieder zwischendurch. Und ansonsten muss man halt ganz, ganz weit rauf. Und beim Wandern sehr fit sein, damit man sie über 2000 Meter auch noch findet.
Ja gut, zu den vorherigen drei genannten Hauptmerkmalen, oder warum man eigentlich in Österreich Schafe halten, ist auch einer der wichtigsten Punkte meines Erachtens die Wolle. Weil doch das Schaf das einzige Nutztier ist, von dem wir auch ein Urtextil bekommen, eben die Wolle, als Rohstoff. Und dem müssen wir einfach wieder Wert geben. Und ich glaube, das hat uns schon ein bisschen zusammengeschweißt, diese Runde, und worüber wir uns heute unterhalten, ist die Bedeutung der Wolle, und warum eigentlich Schafe gehalten worden sind, früher. Mir hat einmal ein alter Bauer erzählt: Früher haben wir Schafe gehalten, um Wolle herzustellen. Jetzt halten wir Schafe meistens wegen Fleisch, Milch, oder um die Landschaft frei zu halten.
800 Tonnen Wolle im Jahr in Österreich: Ein Abfallprodukt?
Die Wolle ist ein „Seitenprodukt“, nennen wir es jetzt einmal so. Aber man darf nicht vernachlässigen, wenn ich jetzt sage: Ich habe 400.000 Schafe in Österreich. Die werden ein- bis zweimal im Jahr geschoren, dann habe ich 800 Tonnen Wolle pro Jahr. Was machen wir denn damit? Was tun wir damit? Ich sage zwar noch „Nebenprodukt“, manche sagen leider „Abfallprodukt“, weil die Verwertung der Wolle schwierig ist. Nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Das hat mit sehr vielen verschiedenen Faktoren zu tun. Aber ich finde es super als Nebenprodukt, und dem müssen wir einfach wieder mehr Wert geben.
Gabi
Mir fällt gerade ein, weil du sagst: Es ist die Verwertung schwierig. Bei unserem Treffen in Sankt Lambrecht ist unter anderem rausgekommen, dass es für Textilbetriebe, also gerade in Österreich, oft sehr schwierig ist, wirklich an einheimische Schafwolle zu kommen. Weil bei uns die Zwischenhändler fehlen. Während es ja in Deutschland zum Beispiel große Merino-Landschaf-Herden gibt, mit über tausend Tieren, wo auf die Masse gesehen dann eine relativ gleichbleibende Wollqualität man herausbekommt – und dann gibt es Zwischenhändler, und die verkaufen das auf dem Großmarkt und so weiter – ist es in Österreich, das hast du auch einmal erzählt, aufgrund der vielen verschiedenen Schafrassen, die wir haben, mit jeweils relativ geringen Stückzahlen, UND dass die Wolle einfach geschoren und zusammengeschmissen wird, ist es relativ schwierig, zum Beispiel eine rassenreine, eine sortenreine Wolle von jetzt nur, zum Beispiel Milchschaf zu kriegen, oder das Kärntner Brillenschaf, oder eben das Tiroler Bergschaf. Weil einfach die Mengen relativ klein sind und das gar nicht mehr so getrennt gesammelt wird. Das ist, glaube ich, eine der Schwierigkeiten, warum die österreichische Wolle jetzt nicht in die Textilproduktion unbedingt geht.
Roland
Genau. Grundsätzlich ist das sicher eine der größten Schwierigkeiten bei uns, weil wir können uns von der Struktur her nicht vergleichen mit anderen großen EU-Ländern, die sehr viele Schafe verhalten, so wie Deutschland, Frankreich, Spanien. Wenn man in diese Richtung schaut, da sind einfach die Strukturen ganz andere. Und wenn ich bei uns jetzt hergehe: Durchschnittszahlen sind immer schwierig, aber der durchschnittliche Betrieb hält neun Schafe, in Österreich. Dann weiß ich: Okay, diese Strukturen sind schwierig zu bedienen. Und wenn ich da einen Wollhändler irgendwo hinschicke, dann wird der mir wahrscheinlich den Vogel zeigen und sage: Ich will jetzt vor dem Betrieb die paar Kilo Wolle abholen? Deswegen funktioniert es in Österreich so/ Ob das das Problem ist, dass die Wolle nicht in der Textilindustrie landet, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, daran kann man arbeiten. Aber grundsätzlich in Österreich funktioniert es so, dass es in fast allen Bundesländern Wollsammlungen gibt. Also die werden organisiert, wo die Betriebe ihre geschorene Wolle hinbringen können. Zum Beispiel in Tirol: Da gibt es zwei Wollsammlungen, im Frühjahr und im Herbst, in Imst oder in Rotholz, dass das tiroler Ober- und das Unterland einfach gut abdeckt, wo die Betriebe die Möglichkeit haben, ihre Wolle dort hinzubringen. Dort wird sie gesammelt, sortiert, gepresst und dann wieder weiter vermittelt. Da tritt der Tiroler Verband dann als Vermittler ein und vermittelt die Wolle weiter. Und der Betrieb bekommt sozusagen ein Geld für seine Kilogramm abgelieferte Wolle.
Und da sind wir genau bei dem Punkt: Da gibt es viele Textilbetriebe, die hätten gerne die beste, ich sage jetzt mal bewusst: Merinowolle. Rein sortiert und beste Feinheit. Die haben wir natürlich auch in Österreich, weil wir auch Merinoschafe halten. Aber nicht zu dieser Menge, und wahrscheinlich nicht zu diesem Zeitpunkt, und nicht zu dieser Qualität, weil halt verschiedene Faktoren mit hineinfallen. Und bei uns ist es gerade zur Zeit eben so, dass es vor allem nach Wolltypen oder Wollsorten zusammen gemischt wird. Das heißt: Ich habe einmal weiße Wolle, ich habe einmal dunkle Wolle, ich habe die melierte Wolle, zum Beispiel. Und dann wird in Oberösterreich Merinowolle separat gesammelt, weil sie sehr gefragt ist. Also so kann man sich das eigentlich vorstellen. Und dann kommen die verschiedenen Wollsorten zusammen, und dann werden sie weiter vermittelt, gewaschen, auf den europäischen Markt, auf den Weltmarkt, wie auch immer, weiter vermittelt, damit sie hoffentlich zu Textilien weiterverarbeitet werden können.
Gabi
Aber nicht nur zu Textilien, sondern auch zu Bettwaren zum Beispiel, teilweise zu Dämmstoffen. Und da gibt es auch einige sehr spannende internationale Ansätze, die aus Schafwolle zum Beispiel Thermo-Elemente pressen, die dann für den Versand von Lebensmitteln eingesetzt werden. Also es gibt schon hie und da Ansätze. Und ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, die Sammlungen, die in Österreich stattfinden, die organisiert ja ihr vom Bundesverband plus eure Landesorganisationen. Und der Großteil dieser Wolle wird, glaube ich, von Deutschland aus aufgekauft, und dann in Belgien gewaschen, und dann irgendwo zu anderen Dingen verarbeitet, aber nicht unbedingt in Österreich. Ich glaube, es kommt relativ wenig zurück davon, derzeit.
Roland
Genau. Es kommt leider wirklich wenig zurück davon. Aufgrund der Faktoren, die ich vorher gesagt habe: Dass es die verschiedenen Sorten der Wolle gibt. Und wenn jetzt ein spezieller Wollverarbeiter eine spezielle Wollsorte haben will, und leider die auf dem Wollmarkt auch sehr günstig kriegt -ich sage jetzt zum Beispiel, sehr günstige Merino-Neuseelandwolle, die halt auch reingeschifft, wir sind am freien Weltmarkt. Ist es natürlich unsere erste Konkurrenz, und der wird sie dann dort bestellen. Das ist halt dann einfach auch eine Kalkulation-Sache. Das heißt, da müsste man einen Mehrwert [schaffen], beziehungsweise sensibilisieren, dass man eigentlich unsere eigenen Produkte auch kaufen könnte.
Gabi
Und es kommt halt immer darauf an, was man daraus machen will. Ich habe ja gehört vom Walter Aigner, der auch noch mal zu Wort kommen wird, in unserer Podcast-Serie über unsere Wolljacke, dass auch die australischen und neuseeländischen Schafbauern inzwischen ganz, ganz wenig für ihre Wolle bekommen. Also dass diese Wolle so billig sein kann, das kommt auch nicht den Bauern dort vor Ort zugute. Es ist eigentlich eine Sache des Weltmarkts und der Welthandelspreise, die einfach diesen wertvollen Rohstoff, so wahnsinnig billig verkaufen.
Roland
Absolut. Und weil er sicher komplett nachgestellt wird zu anderen Rohstoffen oder Textilien, die dominierend sind. Wir wissen es eh: In unseren Alltagskleidungen ist Baumwolle und Polyester ganz oben, und wie viele Leute haben ein Textil aus reiner Schafwolle daheim? Und dann noch von Österreich?
Gabi
Also vielleicht die Strickerinnen und Stricker unter uns. Oder die, die sich einen original Südtiroler Psairer Sarner zulegen, also eine Wollweste aus Südtirol, die dort regional hergestellt wird. Es ist relativ selten.
Auslöser für das Projekt: Der Workshop „regionale Wolle“ im November 2023
Na ja, auf jeden Fall: Du und ich, wir haben großes Interesse daran, dass die österreichische Wolle wieder mehr in Österreich veredelt wird, und zu Produkten weiterverarbeitet wird. Und da haben wir uns eben getroffen, da haben sich unsere Interessen getroffen, als wir uns bei diesem Workshop im vergangenen November in Sankt Lamprecht getroffen haben. Was hat denn dich dazu bewogen, an dem Workshop teilzunehmen und was hast du von dem mitgenommen? Oder soll man vielleicht noch mal sagen, worum es da eigentlich gegangen ist bei dem Workshop? Ich habe einfach Leute eingeladen aus allen Produktionsstufen von Schafwolle in Österreich, deswegen eben den Roland als Vertreter der Bauern und Bauerinnen. Es war ein Spinner da und ein Stricker. Es war jemand da, der Kleidung herstellt und eine Modedesignerin. Und es waren ein paar andere Leute da, die sich mit Schafwolle beschäftigen, auch zum Teil aus Deutschland. Genau, und da haben wir uns an diesem Tag zusammengesetzt und getroffen, um darüber zu reden: Was gibt es in Österreich an Möglichkeiten, mit der Schafwolle was anzufangen, und was braucht es auch? Das war unser Thema dieses Tages. Was hast du persönlich von diesem Tag mitgenommen? Was waren für dich so Kernpunkte dieses Workshops?
Roland
Persönlich hat es mich mal irrsinnig gefreut, bei so was dabei zu sein, außerhalb unserer Landwirtschafts-Bubble, wie wir das oft nennen, weil wir doch eine sehr diverse und gemischte Gruppe waren, bei diesem Workshop. Das hat mich einmal sehr gefreut, dass wir da von der Landwirtschafts-Seite auch dabei sein können. Und die persönliche Motivation natürlich ist, weil das Produkt ja da doch von diesen Tieren kommt, mit denen wir uns täglich beschäftigen, und das die Betriebe draußen halten. Und persönlich hat mir dieser Workshop dann schon aufgezeigt: Wenn man sich mit Menschen unterhält, die das gleiche Interesse haben, und die gleiche Wertschätzung für diesen Rohstoff empfinden, macht das einfach extrem viel Spaß, ist sehr beflügelnd, und man kann da wirklich auch sehr kreativ sein. Ich glaube, das waren wir auch. Wir waren sehr kreativ. Obwohl wir im Nachhinein eigentlich gar nicht so kreativ hätten sein müssen, weil das liegt eigentlich auf der Hand, wenn sich genau die ganze [Produktions-]Kette trifft: Was macht man daraus? Ja, man macht halt was daraus, hätte ich jetzt gesagt. So ist meine Zusammenfassung, mein persönliches Resümee aus dem Tag. Wenn man schon das Know-how auf einem Tisch sitzen hat, und die Motivation gehört natürlich auch dazu, muss man was daraus machen.
Gabi
Ja. Wobei für mich war ja das Ziel dieses Tages, einfach einmal die Leute zusammenzubringen, dass man sich an eine Tisch setzt, dass man miteinander redet. Dass sich die Leute auch gegenseitig zuhören, die in den unterschiedlichen Produktionsstufen sind: was braucht der eine? Was braucht der andere? Und sagen wir es doch konkret: Es war der Gert Rücker von JMB Fashion, der dann am Ende dieses Tages – also wirklich eine Viertelstunde vor Ende – gesagt hat: „Na ja, und was machen wir jetzt? Was ist der nächste Schritt? Kriegen wir ein Textil zusammen, so wie wir da hier sitzen?“ Und dann war so: „Ja klar, kriegen wir das zusammen.“ Es hat schon Pausengespräche gegeben, und in der Mittagspause. Und plötzlich, also wirklich innerhalb von einer Viertelstunde, war dieses Projekt am Tisch, und auch dieses Commitment von allen, die da waren: „Lasst uns gemeinsam ein Kleidungsstück aus österreichischer Schafwolle produzieren.“ Wobei wir jetzt noch hinzufügen: Wobei die Produktionsschritte so weit wie möglich in Österreich stattfinden sollen. Weil wir Betriebe haben, die das können. Und weil von diesen Betrieben jemand da war. Und weil wir diese Betriebe und die regionale Wertschöpfung so weit wie möglich regional behalten wollen.
Und damit hatte ich nicht gerechnet! Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil ich gedacht habe: Mit dem Ergebnis aus dem Workshop rauszugehen, das war der volle Wahnsinn. Das war so ein völliges „High“ am Ende dieser Veranstaltung, und ein Wahnsinn. Das sind echt Leute, die sich gefunden haben und es waren genau die richtigen Leute da.
Projekt „AUTwool“ beim ÖBSZ
Und wir, also die Projekt-Kerngruppe, wir haben uns seit Anfang des Jahres ziemlich ins Zeug gelegt, um dieses Projekt wirklich auf den Boden zu bringen und das wirklich zu ermöglichen, dass eine solche … Es wird eine Jacke werden, beziehungsweise eine Weste wahrscheinlich, ohne Ärmel. Dass dieses Projekt wirklich stattfindet, dass es dieses Produkt geben wird.
Wir haben dann auch einen Namen gefunden, nämlich AUTwool, also mit A-U-T für „Autriche“, für Österreich. Und was auch ganz toll ist, dass wir es wirklich als Projekt beim ÖBSZ, beim Bundesverband für Schaf und Ziegen, ansiedeln konnten, der den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen bietet für die ganze Projektabwicklung und die Administration. Und das ist ziemlich cool. Wir hatten kurz überlegt, einen eigenen Verein zu gründen, oder vielleicht doch schon eine Firma, oder vielleicht als Einzelunternehmer. Aber ich finde es ziemlich cool, dass es jetzt beim ÖBSZ angesiedelt ist, von da, wo die Wolle auch herkommt. Oder sagen wir es so: Von den Produzenten, dass es den Produzenten der Wolle recht nah ist. Und ich finde im Kernteam arbeiten wir da wirklich super zusammen, du und ich und die Stephanie Höcker, die für das Design zuständig ist, und die Hannah Charpin, die das Projekt medial begleiten wird.
Und zum Projektstatus kann man sagen, jetzt, wo wir das aufnehmen, im Mai 2024, haben wir bereits 1.000 kg Wolle vom Tiroler Bergschaf, 800 kg dunkle und 200 kg helle Wolle, die im April geschoren wurden und vom Schaf-und Ziegenzucht Tirol eG gesammelt wurden. Die sind im Ötztaler Schafholzentrum Regensburger, wo sie gewaschen werden und gehen dann weiter zum Spinnen. Das heißt, wir haben schon konkret Material, das unterwegs ist, auf dem Weg, eine Jacke zu werden. Eine wichtige Sache für uns intern ist: Wir arbeiten mit der Frühjahrsschur. Das heißt, die Schafe waren den Winter über im Stall und werden jetzt im Frühjahr geschoren. Das machen wir deswegen, weil wir ja die Weste bis zum Herbst fertig haben möchten und insofern konnten wir nicht auf die Herbstschur warten. Kannst du uns bitte den Unterschied erklären in der Wollqualität von Frühjahrsschur und Herbstschur und worauf man überhaupt beim Scheren achten muss, damit man eine gute Wolle herausbekommt?
Worauf muss man beim Scheren achten, damit eine gute Wolle herauskommt?
Roland
Sehr gerne. Die Schur passiert ja zur Gänze auf den Betrieben. Das heißt, entweder macht es der Landwirt oder die Landwirtin selbst mit einem Schergerät, oder Schafscherer, die spezialisiert sind dafür, fahren durchs Land, kommen hin und scheren die Schafe von einem Betrieb. Egal jetzt, ob Herbst-oder Frühjahrsschur, der Vorgang ist immer derselbe. Der große Unterschied zwischen Herbst-und Frühjahrsschur ist vor allem der, weil im Frühjahr natürlich die Tiere im Stall sind, und im Stall natürlich die „Verunreinigung“ größer sein kann. Was heißt „Verunreinigung? Vor allem z. B. Stroh-oder Futter-Reste, die sich in der Wolle eher verfangen als im Herbst. Weil wenn sie im Herbst zurückkommen von der Weide oder von der Alm, sine sie natürlich von der Witterung schon sauber gewaschener, als über die Wintermonate. Das wäre der eine Unterschied. Wichtig ist aber das, wo es vor allem auch der Schaf- und Ziegenzucht Tirol Verband, oder auch generell in Österreich eben die Empfehlung ist, vor der Schur wichtige Maßnahmen zu tätigen im Betrieb, im Management. Das ist einfach wichtig, wo wir einfach sagen: die Wollqualität ist halt einfach das, was es am Schluss dann auch ausmacht. Das heißt: kriege ich da einen guten Preis für die Wolle oder auch nicht. Da müssen wir uns aber sensibilisieren. Das heißt, sensibilisieren in Richtung von Aufklärungsarbeit.
Gabi
Was bedeutet, „der Betrieb muss gewisse Maßnahmen treffen“? Was heißt das?
Roland
Gehe ich gleich drauf ein. Was sagen wir ihnen? Im Endeffekt ist wichtig bevor der Schur: Die Fütterung. Schauen, dass die Fütterung gut eingestellt ist. Das heißt, keinen großen oder abrupten Futterwechsel vor der Schur. Was heißt ein Futterwechsel? Man merkt das selber: Wenn man ein Futtermittel ändert, geht es nicht darum, dass das Schaf komplett was Anderes zum Fressen kriegt. Aber zum Beispiel einen zweiten oder dritten Schnitt, also vom Grundfutter her, dass man da keine abrupte Umstellung macht, weil das zum Beispiel mit Durchfall einhergehen kann, und dann sind die Tiere eher verschmutzt. Dann bei der Fütterung generell nicht über Kopf, oder nicht einstreuen, oder nicht das Futter so zugänglich machen, dass die Tiere das über den Kopf schmeißen können. Das heißt, am Körper, wo die Wolle ist. Das heißt, so wenig wie möglich Verschmutzung der Tiere durch Stroh-und Futterreste. Das heißt, die Raufen vielleicht nicht so ganz voll machen. Oder das Einstreu erst dann machen, wenn die Tiere nicht im Laufstall sind, also nicht über Kopf einstreuen. Das sind z. B. Maßnahmen, wo man einfach entgegenwirken kann, dass man sagt: So wenig wie möglich Fremdpartikel in der Wolle, die dann geschoren wird. Und dann ist noch die Sauberkeit bei der Schur. Nicht in der Box, oder nicht irgendwo drinnen scheren, wie man es früher oft gemacht hat. Wichtig ist ein planbefestigter Boden, wo man das Tier hernimmt, dann die Schur vollzieht. Das heißt, da ist es sauber, da kann man wegkehren. Die geschorene Wolle fällt sozusagen auf einen trockenen und sauberen Boden. Und dann kann sie auch sortiert werden. Das heißt, man kann dann auch auf die Empfehlung, dass man wirklich stark verschmutzte Wollpartien, vor allem im Hinterbereich oder im Bauchbereich, wenn die wirklich stark verschmutzt ist, dass man die aussortiert. Und dass man sich dann auf die reine und sauberste Wolle fokussiert. Das ist so die Empfehlung. Und die [diese Wolle] dann gesammelt wird, und die dann zur Wollsammlung gebracht wird, und dann natürlich auch die Qualität steigt, von der gesamten Wolle. Also wichtig ist Sensibilisierung. Darauf aufmerksam machen, was kann man im Management tun? Das heißt: in der Fütterung, in der Haltung, in der Einstreu. Und vor allem dann auch: Was kann ich während der Schur tun? Also Sauberkeit, planbefestigter Boden, dann habe ich schon einmal 80% sicher richtig gemacht. Und dann ist es natürlich auch noch das oben drauf, dass ich in die Sortierung ein bisschen reinschaue. Und mich einfach ein bisschen auch fallen lasse und sage: „Okay, ein Bauer oder eine Bäuerin kennt seine Schafe eh am besten, was eine schöne Wolle ist, und was keine schöne Wolle ist.
Gabi
Okay, ja. Irgendwas holt jetzt zu haben, das habe ich jetzt vergessen. Ja, sehr spannend. Ja, genau. Du hast auch gesagt, dass wir jetzt Wolle bekommen haben, vorwiegend auch von Betrieben, die ihre Tiere vorbereitet haben für Wettbewerbe. Das heißt, die extra hübsch gemacht haben vorher, extra gereinigt, vielleicht ein bisschen gebürstet oder vielleicht sogar gewaschen, damit sie beim Wettbewerb gut ausschauen. Und wir haben jetzt also hoffentlich sehr saubere 1.000 Kilo Wolle bekommen, die wir auf den Weg schicken, bis November eine Weste aus Tiroler Bergschaf zu werden.
Roland
Genau. Da vielleicht grundsätzlich war es eine kleine, auch Seiten-Intention von Tiroler Betrieben, diese Wolle zu sammeln, weil diese Wettbewerbe/ Wir haben ja bei uns Ausstellungen, wo wir am Wochenende hinfahren, und unsere Tiere herzeigen, und da gibt es verschiedene Ausstellungen für die verschiedenen Rassengruppen, wo die Betriebe auch ihr züchterisches Werk und Können herzeigen können, und auch prämiert werden. Und für den Zweck werden die Schafe hergerichtet, meist gewaschen, gebürstet, einfach gestriegelt, dass man halt schön ausschaut, als wie wenn wir am Sonntag in die Kirche gehen. Das heißt, sie werden eigentlich vorgewaschen.
Wir nehmen das Bergschaf, weil’s viel davon gibt
Aber warum wir eigentlich vor allem auch in Tirol gelandet sind, ist, weil wir gesagt haben: „Hey, wir wollen vielleicht aus der Bergschafwolle was machen, die doch ein bisschen robuster ist. Aber wir haben viel von der Bergschafwolle. Das heißt, das Tiroler Bergschaf an sich, oder die Bergschaf-Rassen – da zählt ja auch das braune Bergschaf dazu, das weiße Bergschaf dazu, das Juraschaf dazu – da haben wir einfach die meisten Tiere, über ganz Österreich. Das heißt de facto auch gleich: am meisten Wolle. Das war vielleicht auch unser Zugang dazu, dass wir gesagt haben: „Okay, wir haben uns bewusst für diese Bergschaf-Rasen entschieden, dass wir dieser Wolle einen Wert geben und aus dieser Wolle dieses Kleidungsstück machen wollen.“ Mit dem kleinen Side-Effekt, mit der Hoffnung, dass wir eine sehr gute und saubere Wolle bekommen haben, die ja jetzt gerade in der Wasch-Anlage wahrscheinlich sich herumdreht und dann bereit ist für die Weiterverarbeitung.
Gabi
Genau, das ist der Grund, warum Bergschaf … Wobei, jetzt bringen wir mal dieses eine Projekt auf den Boden. Und dann kann man für die nächsten Jahre überlegen: Was gibt es denn noch? Von welchen Schafrassen gibt es denn auch relativ viel Menge in Österreich, wo man vielleicht dann ein weiteres oder auch ein anderes Produkt vielleicht einmal aus einer feineren Wolle machen kann. Auf jeden Fall, jetzt sind wir gerade dabei, eine Weste zu entwickeln, die auch die Eigenschaften von der Wolle vom Tiroler Bergschaf möglichst gut nutzt. So viel sei schon mal verraten. Wunderbar. Super. Vielen Dank, lieber Roland, für das Gespräch und für diesen ersten Einblick. Und ich wünsche uns allen, also dir und mir und uns als Projektteam und den Betrieben, die jetzt teilnehmen an diesem Projekt, viel Erfolg und toi, toi, toi für die Wolle Weste 2024.
Roland
Danke schön.



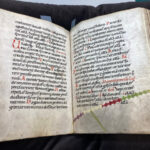


Schreibe einen Kommentar