Aktualisiert am 4. Juli 2025.
Veronika Persché ist Strick-Künstlerin. In ihrem Wiener Strickatelier produziert sie gestrickte Einzelstücke und Meterware für heimische und internationale Kreative, für Firmen- und Privatkund*innen.
Die Stoffe fertigt sie mittels maschineller Strickerei aus Wolle, Garn oder Zwirn. In der heutigen Episode erzählt sie uns von ihrem beruflichen Werdegang, wir sprechen über Handstrickmaschinen und darüber, was du machen kannst, wenn du zum Beispiel am Dachboden selbst eine alte Strickmaschine findest.

- Webseite von Veronika Persché.
- Instagram Account von Veronika Persché
- Der erfolgreiche österreichische, international bekannte Gegenwartskünstler Erwin Wurm
- Textilportal Podcastfolge 019 mit Anita Pavani
- „Merino 28/2“ ist ein Begriff für die Garnstärke. Die Wolle wird so fein versponnen, dass 1 kg 28 km Faden beinhaltet. Dann werden zwei dieser Fäden miteinander verzwirnt. Das ergibt: 28/2
- Diese Firma aus Berlin stellt Gummibänder aus Naturkautschung her, die Regenwürmern gut schmecken: Charle Premium Haberdashery
- Die Herstellerin von Strickwaren auf der schwäbischen Alb, die über Jahre hinweg immer die gleichen Garnfarben verwendet, hat die Marken Flomax und Albmerino.
- Die britische Machine Knit Community.
- Textile Kultur Haslach im Mühlviertel/ Oberösterreich mit Ausstellungen, Kursen und dem jährlichen Webermarkt:
- Die GEA Akademie im Waldviertel, Niederösterreich.
- Zürcher Stalder in Lyssach bei Bern, Wollgroßhändler, Handarbeits-Kurse und -Ausbildungen zum Stricken, Klöppeln, Weben.
- Video von der Sockenstrickmaschine bei Willi Huber Wolle im Lungau
- Online-Kurs Strickstoffe vernähen von Veronika Persché
- 00:00:00 Intro
- 00:00:54 Ausbildung und erste Aufträge
- 00:01:45 Aufträge aus der Kunst-Szene
- 00:03:24 Kund:innen und Aufträge im Strickgeschäft
- 00:06:58 Selbständigkeit und Firmengründung
- 00:08:15 Feminismus und politische Themen in Veronikas Projekten
- 00:11:21 Arbeitsalltag
- 00:13:16 Materialwahl und Gedanken zur Nachhaltigkeit
- 00:18:56 Alte Handstrickmaschinen – Faszination und Nutzung
- 00:23:17 Mustersteuerung mit Lochmusterkarten und andere
- 00:28:25 Kurse und Workshops für Strickmaschinen
- 00:34:28 Fertige Strickstoffe vernähen (Online-Kurs)
- 00:38:57 Abschluss und Kontakt
Gabi (00:54)
Liebe Veronika, wir treffen uns heute bei dir in deinem Atelier im 16. Wiener Gemeindebezirk. Das ist ein altes Gewerbelokal, wo früher eine Metallgießerei war, mit hohen Decken und mehreren deiner wunderbaren Strickmaschinen im Hintergrund und natürlich auch ganz viele von deinen tollen gestrickten, zweifarbigen, dreifarbigen Kunstwerken. Erzähl mir doch bitte zum Beginn von deinem beruflichen Werdegang. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute stehst?
Veronika (01:25)
Eigentlich habe ich eine klassische, altmodische Karriere. Ich habe die Ausbildung in der Spengergasse gemacht. So ganz klassisch war es dann nicht, weil ich nicht aus Wien weg wollte und eigentlich meine Lehrjahre in einem Betrieb machen wollte, in einer Strickerei. Da habe ich aber keinen Job gefunden. Dann habe ich alle möglichen Nebenjobs gehabt und habe Leute kennengelernt, die Mode machen.
Mit meiner ersten kleinen Strickmaschine habe ich dann für einzelne von diesen Designerinnen Strickstoffe produziert. Das hat ganz gut funktioniert. Ich habe dann mein Konzept angepasst und nicht nur die Stoffe produziert, sondern auch den gesamten Prototypen gemacht, also den gesamten Pullover zum Beispiel. So hat sich das dann immer weiterentwickelt. Schritt für Schritt bin ich gewachsen und ist mein Geschäft mitgewachsen.
Gabi (02:20)
Ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass es auch schon relativ früh Kooperationen mit Künstlern gab, wo du solche – das schaut aus wie so ein Riesen-Ei – eingekleidet hast in ein Strickwerk, oder ein quadratisches Bild, wo ein Ärmel raushängt. Du hast schon relativ früh mit Künstlern zu tun gehabt und für die gearbeitet.
Veronika (02:38)
Ja, ich glaube, das was du da gesehen hast, das war vom Erwin Wurm. Es gibt relativ wenig Leute, die eine Strickerei so betreiben wie ich – nämlich dass ich Einzelanfertigungen mache und auch kleine Mengen und Spezialanfertigungen. So ist das Atelier vom Erwin Wurm direkt auf mich zugekommen. Die haben mich quasi aus dem Telefonbuch herausgesucht, und dann habe ich auf einmal Strickstoffe für die Skulpturen produziert. Aber es ist ganz unterschiedlich. Die Wiener Modeszene ist klein und die Kunstszene ist auch nicht so groß, und es spricht sich halt herum. So kommt man auch zu interessanteren Aufträgen.
Gabi (03:24)
Wer sind denn deine Kundinnen? Sind das eher Privatpersonen oder Institutionen oder ist es ein Mix aus beiden?
Veronika (03:34)
Es ist eigentlich kein Mix, sondern sind vor allem Firmen, Institutionen oder Selbstständige wie ich, also Einzelunternehmen. Am Anfang waren es hauptsächlich Modeleute, die als Einzelunternehmen gearbeitet haben und mich beauftragt haben. Dann hat sich das auch in Richtung bildende Kunst erweitert, und zuletzt auch viel fürs Theater – also Kostümbildnerinnen, die für größere Häuser Strick für Kostüme brauchen.
Gabi (04:08)
Die Liste liest sich ziemlich beeindruckend, finde ich. Da waren Bregenzer Festspiele, Bayreuther Festspiele, Theater an der Wien, Theater in der Josefstadt. Dann auch im Film, oder für eine TV-Serie hast du eine gestreifte Strickjacke gestrickt. Das finde ich schon sehr beeindruckend, wenn man so die Galerie deiner Werke, oder wo du beteiligt warst, anschaut. Gut, das sind auch jetzt schon 24 Jahre, die du in diesem Geschäft bist. Da kommt schon was zusammen.
Du hast auch schon angesprochen – wie finden deine Kundinnen zu dir? Geht das quasi von allein? Ist das viel Mundpropaganda oder musst du viel Werbung betreiben?
Veronika (04:44)
Interessant ist, dass ich in meinen Anfängen schon viel Werbung oder viel Aufwand betrieben habe, mich bekannt zu machen. Ich war auf Messen, bin teilweise auch nach Berlin oder nach London gefahren und habe ein bisschen Klinken geputzt und versucht, vor allem in der Modeszene Auftraggeber zu finden.
Bei den Kostümprojekten funktioniert das interessanterweise anders. Ich habe auch schon relativ früh eine Website gemacht, 2004 glaube ich. Aber beim Theater und bei den Kostümleuten geht viel mehr wirklich über Mundpropaganda. Da muss man wirklich mal irgendwo gewesen sein, mit einem Regisseur gearbeitet haben, eine Kostümbildnerin kennen, und das hat sich dann herumgesprochen. Es ist unterschiedlich und auch ein Auf und Ab. Manche Jahre kann ich mich vor Aufträgen gar nicht retten, und andere Jahre ist eher bisschen Flaute.
Gabi (05:52)
Das ist witzig, es fällt mir gerade ein, dass ich mit einer Stoffhändlerin, Anita Pavani, mal ein Interview geführt habe, die die Webseite naturstoff.de betreibt. Da war ich völlig aus dem Häuschen, weil die plötzlich gesagt hat, dass sie ganz viele Aufträge von der Filmindustrie bekommt. Da hatte sie auch irgendwelche Kontakte zu einer Kostümbildnerin, und manchmal, wenn sie im Kino sitzt, sieht sie plötzlich ihren Stoff, den sie entworfen hat. Das finde ich sehr spannend. Ich stelle mir vor, dass es schön ist, wenn man im Theater sitzt und dann sieht, dass die Leute eben dieses von dir angefertigte Kostüm tragen. Das ist schon was Besonderes, finde ich.
Veronika (06:29)
Ja, Kostümbild macht auch wirklich viel Spaß. Das ist auch so schön, weil da viele Professionisten zusammenarbeiten. Die haben dann oft auch Schuhmacher oder Modisten. Und die meisten sind sehr professionell in dem Sinn, dass sie auch wissen, wie viel Vorlaufzeit das braucht oder wie viel Aufwand das sein kann. Man muss nicht ständig erklären. Das ist sehr angenehmes Arbeiten.
Gabi (06:58)
Was würdest du denn jemand raten, der sich vielleicht ebenfalls als Strickerin selbstständig machen möchte? Oder was hättest du gern früher gewusst in Bezug auf Firmengründung und Selbstständigkeit?
Veronika (07:11)
Das ist ganz witzig, ich kann eigentlich keinen wirklichen einzelnen Rat geben. Ich habe es Schritt für Schritt gemacht und eher langsam. Ich bin langsam gewachsen und habe in den Anfängen immer einen Nebenjob gehabt zur Absicherung. Das war meine Art, weil ich mich nicht Hals über Kopf hineinstürzen wollte. Das ist Mentalitätssache, würde ich sagen.
Ansonsten war ich Gott sei Dank gut vorbereitet, weil es damals ein Programm für Unternehmensgründerinnen gab, wo ich dabei war. Ich habe einfach Glück gehabt und gute Leute und gute Mentorinnen gehabt.
Gabi (08:03)
Und gut vorbereitet sein, das ist auch etwas – sich vorher schon sehr gut erkundigen und schon vielleicht erste Kontakte knüpfen.
Veronika (08:11)
Ja, langsam wachsen.
Gabi (08:16)
Wenn ich mir diese Vielzahl von beeindruckenden Projekten auf deiner Webseite anschaue, dann fällt mir auf, dass du in deinen eigenen Projekten häufig feministische und auch politische Themen aufgreifst, in denen du zum Beispiel für Frauenrechte und reproduktive Rechte eintrittst. Ein Slogan ist zum Beispiel: „Der Platz der Frauen ist im Widerstand.“ Und es gibt so ein Modell, wo eine Frau ihre Muskeln zeigt, oder eben dieser eine Schal, der offensichtlich eine Vulva mit Stinkefingern zeigt, wo ich erst ein bisschen gerätselt habe. Oder auch das Portrait von Ute Bock, das für mich so ikonisch ist für dein Werk. Ute Bock, für alle, die sie nicht kennen, war eine ganz bewundernswerte Frau und Flüchtlingshelferin. Warum ist das Thema Frauenrechte und Feminismus für dich so wichtig?
Veronika (09:09)
Ja, same old shit, das ist einfach immer noch aktuell und es ist immer noch zu wenig. Wir haben schon einiges erreicht, von einer wirklichen Gleichberechtigung sind wir immer noch weit entfernt. Mir ist das sehr bewusst und ich möchte, dass das allen so bewusst ist, denen es vielleicht noch nicht ist, die es noch nicht so im Kopf haben. Wenn ich da einen kleinen Beitrag leisten kann, um das mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, unter die Leute zu bringen, dann mache ich das.
Gabi (09:41)
Und gerade von dem Schal, den es in verschiedenen Farbstellungen gibt, das ist auch so hintergründig, fast subversiv, als wenn man das am Anfang gar nicht erkennt. Und ich glaube, du spendest ja auch ein Drittel der Einkünfte dann an Frauenhäuser.
Veronika (09:58)
Genau. Das Motiv mit dem Uterus, muss ich dazu sagen, das habe ich mir abgeschaut. 2016 oder 2017 gab es den Women’s March in Washington, und dort habe ich das auf einem Transparent gesehen und habe das für einen Pullover für mich privat verwendet. Nachdem ich da so ein Echo bekommen habe und jeder so einen Pullover haben wollte – ich mache nicht für jeden einen Pullover, aber ich kann Schals machen – habe ich mich dann mit diesem Motiv und mit dem Muster gespielt.
Gabi (10:39)
Sodass es wiederholbar ist, dass sich das wiederholt.
Veronika (10:42)
Genau, es ist ein All-over-Pattern, als Double Face gestrickt. Ich war einmal schon aktiver, aber ich bin immer noch interessiert und aktiv in verschiedenen Initiativen, zum Beispiel Pro Choice Austria, die sich für reproduktive Rechte einsetzen. Es ist halt wichtig, dass diese Initiativen weiter bestehen bleiben, und wenn ich das irgendwie unterstützen kann, beziehungsweise wenn jemand einen Schal kauft und das gleichzeitig mit unterstützt, bin ich sehr froh.
Gabi (11:18)
Coole Sache. Wie sieht ein typischer Tag in deinem Arbeitsalltag aus? Oder gibt es den einen typischen Tag? Oder sind die unterschiedlich, weil du so viele verschiedene Projekte machst?
Veronika (11:31)
Meine Tage sind schon eher unterschiedlich, wobei es phasenweise ist, würde ich sagen. Das Gute ist ja, dass ich selbstständig bin und mir die Zeit selber einteilen kann. Nichtsdestotrotz habe ich so meinen Rhythmus. Ich mache meistens zuerst zu Hause ein bisschen Administration und Organisation und bin dann ab 11 Uhr hier im Atelier und mache, was anfällt. Wenn Termine sind, wenn Kundinnen kommen, oder wenn andere Termine sind, dann muss ich natürlich hier sein.
Ansonsten arbeite ich meine Aufträge ab. Oft sind das zwei, drei parallel. Dann macht man zum Beispiel für den einen Auftrag ein paar Proben, für den anderen muss man noch Material aussuchen und bestellen, für den dritten muss man das Teil zusammennähen. Das mache ich dann bis am Abend und dann gehe ich heim.
Gabi (12:34)
Außer du bist gerade unterwegs auf einer Messe oder kursgebend.
Veronika (12:38)
Stimmt, genau. Das wäre jetzt der typische Atelier-Dienstleistungstag. Es ist aber auch so, dass ich teilweise auswärts bin, weil ich unterrichte, weil ich Workshops gebe oder weil ich gerade involviert bin in einem Kunstprojekt, wo es auch verschiedenste Termine gibt. Da gibt es dann Proben oder auch Material – ich weiß nicht, viele Meter, waren es 60 Meter oder mehr – flammschutzhemmend ausrüsten müssen, und dann musste ich das Material aus Kagran holen. Es ist sehr unterschiedlich.
Gabi (13:16)
Mit welchen Garnen arbeitest du vorwiegend oder am liebsten? Hast du Lieblingsgarne oder hängt es einfach komplett vom Projekt ab, was du verarbeitest?
Veronika (13:28)
Sowohl als auch. Für das Maschinenstricken braucht man Garne, die von der Aufmachung her auf einer Kone sind. Wenn etwas im Knäuel oder im Strang ist, dann ist es schon einmal schwieriger. Zusätzlich muss man sagen, die meisten Garne für die Maschine sollten nicht zu dick sein – die Maschine hat feinere Nadeln.
Dann ist schon einmal der Händlerkreis eingeschränkt, wo ich überhaupt meine Materialien beziehen kann. Jetzt habe ich zum Beispiel einen österreichischen Händler, bei dem ich seit meinen Anfängen bestelle. Der hat die konventionelle Merino 28/2. Das ist so der Klassiker, den alle Strickereien, zumindest in ganz Europa, verwenden. Und der hat diese Qualität in über 200 Farben in einer gleichbleibenden Farbpalette, und das ist halt großartig. Da können sich meine Kundinnen alles aussuchen, das ist super, und es lässt sich gut verarbeiten. Das ist einfach aus diesen praktischen, pragmatischen Gründen mein Lieblings- oder mein Go-To-Material.
Natürlich ist aber – man weiß, Merino ist jetzt nicht die beste Faser der Welt, also schon als Wollfaser, aber so wie es erzeugt wird und wie die Haltungsbedingungen sind von den Tieren, ist es kritisch. Ich muss vorausschicken, ich bin keine Veganerin, ich verwende schon Wolle und tierische Produkte, weil Wolle unschlagbar ist, kann man nicht anders sagen. Aber die Merino-Wolle hat eben große Probleme.
Je nach Auftrag würde ich nicht nur konventionelle Garne verwenden, sondern auch nachhaltige – also ökologisch angebaute bei der Baumwolle zum Beispiel, oder aus kontrolliert biologischer Tierhaltung stammende bei der Wolle, oder Tencel. Viskose-Fasern, die nachhaltig hergestellt sind, lassen sich schön verarbeiten und haben tolle Eigenschaften. Viskose ist schon leiwand [toll], finde ich.
Aber im Grunde, wenn jetzt ein Kunde kommt und er will unbedingt 100% Elasthan und Polyester, dann ist es so.
Gabi (16:07)
Ich denke auch, für gewisse Strickstücke, die sehr eng anliegend sein sollen, nimmt man halt normalerweise einen Gummifaden dazu.
Veronika (16:15)
Genau. Ich bin auf der anderen Seite immer – ich versuche mich da auch sehr zu informieren und weiterzubilden und hänge jetzt gerade ganz oft in Online-Vorträgen drinnen in letzter Zeit. Es tut sich auch ganz viel, was das Aufbereiten von Textilien betrifft und von Fasern. Jetzt gibt es ein Institut in Schweden, die schauen, dass man das Elasthan auflösen kann, wenn das in den Post-Consumer-Textilien vorhanden ist. Mich interessiert das sehr und ich bin da dran.
Gabi (16:54)
Das ist interessant, weil ich mir gerade überlege – mir fällt jetzt nicht ein, wie sie heißen, aber es gibt in Deutschland eine Firma, die stellt jetzt Gummibänder unter anderem her aus Kautschuk, also aus Naturlatex. Und die haben jetzt gemeinsam mit dieser Wurmkiste – es gibt so eine Wurmkiste, die man sich zu Hause hinstellen kann, wo man die Gemüseabfälle reintut und dann sind Kompostwürmer drin – Tests gemacht, um zu schauen, wie gut dieser Naturkautschuk abbaubar ist. Das war faszinierend. Sie haben gesagt, die Würmer stehen total auf diesen Naturkautschuk. Man kann das dann einfach kompostieren. Das heißt, die machen ihre Gummibänder jetzt mit Biobaumwolle und Naturkautschuk. Und wenn sie solche Gummibänder machen – da gibt es ja auch dünnere, ganz dünne Gummis – da muss man sich mal anschauen, ob das vielleicht eine Variante wäre? Gummi ist wahrscheinlich eher schwierig zu verstricken.
Veronika (17:55)
Ja, weiß ich jetzt selber nicht. Was mir nur einfällt dazu ist, ich habe gehört, dass das eine österreichische, eine Waldviertler Firma ist, die diese Gummibänder macht mit Naturkautschuk.
Gabi (18:05)
Ich kenne sie als deutsche Firma. Ich verstehe das gut mit deinen 200 Farben in der Merino. Ich bin inzwischen der Überzeugung: Wolle ist besser als keine Wolle. Oder Wolle ist besser als Nicht-Wolle. Und wenn das natürlich 200 Farben hat, dann stelle ich mir das vor wie meine Stickgarne, die auch aus irgendeiner Baumwolle sind und wo ich auch 500 Farben habe und dann wie aus einem Aquarellkasten einfach auswählen kann. Und genau was du gesagt hast: Die immer selben Farben. Ich war vor Kurzem bei einer Firma auf der Schwäbischen Alb, die seit vielen Jahren immer wieder dieselben Farben verwenden, was dann auch eine Form von Nachhaltigkeit ist. Wenn ich heute ein Kleidungsstück kaufe, und in fünf Jahren wieder, dann kann ich das immer noch kombinieren, weil sie exakt denselben Farbton haben. Das ist dann auch für die Langlebigkeit der Dinge ein Kriterium.
Ich habe dich ja zum ersten Mal wahrgenommen am Schneidereimarkt 2016 damals im Brick 5, im 15. Wiener Gemeindebezirk. Damals, und auch heute noch, hat mich sehr fasziniert, dass du auf mechanischen Strickmaschinen arbeitest – also teilweise eben solche, wie sie in den 50er und 60er Jahren beliebt und auch im Hausgebrauch vorhanden waren. Hier im Atelier hast du auch eine große elektrische stehen, was gescheit ist für die Meterware, die du auch anbietest. Auf jeden Fall habe ich das komplett faszinierend gefunden, dass du da mit einer alten Strickmaschine stehst, wo man mit so einem Schlitten hin und her fährt. Ich weiß nicht, wer von den Hörerinnen jetzt weiß, wie das ausschaut. Ich werde einfach ein Bild noch dazu tun. Die waren ja in den 50er, 60er Jahren sehr beliebt und verbreitet, aber heute kennt das kaum jemand mehr. Oder gibt es da ein Revival?
Veronika (20:07)
Immer wieder mal, wenn das Gespräch draufkommt, dass ich mit der Strickmaschine arbeite, dann kriege ich zu hören: „Ah ja, meine Tante hat so etwas gehabt und da hat sie immer das und das gemacht“, und dann fangen lange Geschichten von dieser Tante an. Ich sage dann immer, ich hätte gern 10 Cent für jeden, der mir so eine Geschichte erzählt, dann wäre ich reich. Es war nämlich nicht nur in den 50er, 60er Jahren. Es hat in den 50ern begonnen circa, aber bis in die späten 80er wurden Strickmaschinen für den Hausgebrauch produziert und immer weiterentwickelt. Das waren unterschiedlichste Modelle, und die waren wahnsinnig verbreitet. Wirklich, ich würde sagen, auf jedem zweiten Dachboden liegt eine, weil das war ein ziemlicher Renner.
Die waren zwar nicht billig – da sind ein paar Monatsgehälter oft draufgegangen. Aber das war in einer Zeit, wo Kleidung noch kein Wegwerfprodukt war, sondern im Geschäft auch ziemlich teuer. Da haben sich das viele, vor allem Frauen – es ist an Hausfrauen vermarktet worden – angeschafft, um Geld zu sparen und für die Familie oder den Bekanntenkreis, teilweise für die ganze Ortschaft zu stricken. Es war ein sehr anspruchsvolles Hobby, aber es war irgendwie – ich stelle mir das oft so vor, so ähnlich wie der Papa eine Modelleisenbahn kriegt und die Mama dafür die Strickmaschine. Hobbies für Frauen müssen immer noch etwas Nützliches haben. Oder so war es zumindest. Das war recht verbreitet.
Was ich faszinierend finde an den Maschinen ist – weil in meiner Ausbildung hatten wir solche Maschinen nicht. Es gibt auch andere Handstrickmaschinen, wir haben schon mit der Hand auf Maschinen gearbeitet, das waren robustere Modelle, ein bisschen anders gebaut, wie sie teilweise auch heute noch in der Produktion verwendet werden. Der große Vorteil aber von meiner ersten Haushaltsstrickmaschine war der, dass die schon immer eine Mustersteuerung eingebaut gehabt haben. Das ist bei diesen anderen Modellen, die wir in der Schule hatten, nicht so. Das ist halt für mich faszinierend, weil diese Maschinen sehr vielseitig sind und weil man ganz viel machen kann und ich ganz viel auch zeigen kann in meinen Kursen.
Der große Nachteil ist auf der anderen Seite: Es gäbe schon längst ein Revival – vielleicht gibt es das auch auf eine Art -, aber das Revival wäre definitiv größer, wenn es neue Maschinen gäbe. Leider werden die so nicht mehr produziert und man muss mit den alten gebrauchten Maschinen arbeiten, die halt teilweise Defekte haben oder wo Teile aus Plastik sind, wo der Weichmacher sich verflüchtigt hat, und die brechen. Die alten Geräte sind halt fehleranfällig und deswegen glaube ich hat es noch nicht dieses Revival gegeben, wie es vom Interesse her schon vielleicht wäre.
Gabi (23:17)
Ich folge inzwischen einer britischen Strickerin, die so einen Maschinen-Strick-Club eröffnet hat, wo man jeden Monat ein neues Projekt stricken kann und wo es auch Hilfestellungen gibt. Ich habe vor zwei Jahren aus einer Verlassenschaft so eine Strickmaschine herausgekauft, die das hat, was du gerade gesagt hast: Die hat hinten so etwas, wie bei einer Schreibmaschine mit dem Einzug, wo man eine Lochmusterkarte reinstecken kann. Es sind auch Lochmusterkarten dabei, die schon dieses Muster vorgestanzt haben. Aber ich könnte auch selber mir ein Muster stanzen. Wenn ich den Ehrgeiz hätte, selber Muster zu entwerfen, dann könnte ich das machen. Soweit ich mitgekriegt habe – da gibt es halt auch Strickmaschinen, die haben schmälere Abstände und dünnere Nadeln, und dann gibt es welche, die haben breitere Abstände und breitere Nadeln. Genauso wie ich beim Handstricken dünnere oder dickere Nadeln verwende und das entsprechende Garn, kann ich auch da dünnere oder dickere verwenden. Wenn ich das ernsthaft betreiben würde, dann könnte ich mir auch mehrere Strickmaschinen in unterschiedlicher Stärke anschaffen. Habe ich das richtig verstanden?
Veronika (24:20)
Genau. Solche Fragen sind ein bisschen gefährlich bei mir, weil da höre ich dann oft nicht mehr zum Reden auf. Was du beschreibst, ist die Mustersteuerung von Maschinen. Und das muss ich erwähnen, weil so eine war der erste digitale Datenträger. Von Joseph Marie Jacquard, der diese Lochkarte erfunden hat für die Webmaschinen. Von dem leitet sich das ab und daraus wurde nachher die erste Rechenmaschine entwickelt und sukzessive dann auch die Computer.
Genau das ist das auch, was ich so schön finde an diesen kleinen transportablen Maschinen. Ich gehe damit teilweise in die Schulen und zeige den Kindern, was eigentlich digital bedeutet: Nullen und Einsen. Loch und kein Loch. Sie können dann wirklich anhand von dieser Mechanik verstehen und nachspielen, wie das abläuft, weil die Maschine das Eins zu Eins abbildet, was auf der Lochkarte drauf ist. So sieht man, was die Nadeln machen und wie das Muster erzeugt wird. Das ist eins der großen Features, also auch didaktisch, um den Leuten das zu erklären.
Gabi (25:38)
Sehr cool. Wie funktioniert das dann bei dir bei diesen dreifarbigen Mustern? Da hinten hängt eins, das ist so blau, rosa und weiß?
Veronika (25:47)
Vom Prinzip her ähnlich. Die Maschine muss wissen, welche Nadel welche Farbe kriegt und welche Masche stricken soll. Oder welche Bindung. Wenn ich Muster entwerfen möchte, dann muss ich einerseits mit Bindungen arbeiten, um eine Struktur zu entwickeln. Bindungen meine ich jetzt in dem Fall nicht nur – es gibt rechte und linke Maschen, das kennt man vielleicht noch. Es gibt dann auch noch einen Umschlag, wie beim Patentstricken beim Handstricken. Und es gibt noch ein paar andere Mustertechniken, aber das ist ein weites Feld.
Jedenfalls muss ich mir zuerst überlegen, welche Bindung will ich haben? Welche Nadeln sind in Betrieb? Und dann muss ich auch überlegen: Will ich mehrere Farben haben? Welche Nadeln sollen welche Farbe kriegen? Welches Muster? Textildesignerin ist ein Beruf, und beim Stricken muss man sich spezialisieren. Heutzutage kann man dazu natürlich auch Computerprogramme nutzen und muss nicht händisch Patronen zeichnen, was wir auch noch in der Schule gemacht haben.
Gabi (26:52)
Und selbst die Haushaltsstrickmaschinen hat es, glaube ich, auch schon früher gegeben in der manuellen Version, wo ich mit einem Schlitten so hin und her fahre und jedes Mal eine Reihe abstricke. Und dann auch schon in einer elektrifizierten, wo sich das schon selbstständig hin und her gefahren hat, soweit ich weiß.
Veronika (27:09): Da muss man ein bisschen unterscheiden. Eine Strickmaschine hat Nadelbetten, wo die Nadeln nebeneinander angeordnet sind. Dann gibt es einen Schlitten, der sich darüber bewegen muss. Der hat den Faden eingefädelt und muss rechts und links hinüberfahren. Das sind Flachstrickmaschinen. Die Schlittenbewegung kann auf den meisten Maschinen, bis auf die Industrieautomaten, händisch erfolgen.
Die Mustersteuerung und die Schlittenbewegung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann eine Strickmaschine mit einer Lochkartenmustersteuerung haben, die ohne Strom funktioniert, sondern rein mit einer physischen Lochkarte. Den Schlitten bewege ich dann mit der Hand – dann habe ich eine rein manuelle Maschine. Ich kann aber auch einen Motor an die Maschine anhängen, dann bewegt sich der Schlitten elektrisch. Die Lochkarte ist immer noch rein mechanisch, ohne Strom. Die späteren Maschinen waren dann schon elektronisch, digital gesteuert mit Stromanschluss. Da ist ein kleiner Computer drinnen für die Mustersteuerung.
Gabi (28:26): Wenn ich jetzt eine alte Strickmaschine am Dachboden entdecke – von der Oma, der Mutter oder der Tante – und mich damit beschäftigen will, kann ich bei dir Kurse machen, richtig?
Veronika (28:43): Ja.
Gabi (28:44): Wo kann ich dich treffen? An welchen Orten gibst du Kurse und was kann ich bei dir lernen?
Veronika (28:48): Ich mache schon seit 2004 Kurse. Die Organisation ist ziemlich aufwendig, deswegen mache ich das nicht auf eigene Faust in meinem Atelier, sondern auf Einladung von Vereinen oder Institutionen. Ich bin zum Beispiel seit etlichen Jahren regelmäßig bei der Textilen Kultur Haslach in Oberösterreich im Mühlviertel. Die haben dreiwöchige Symposien und da habe ich dieses Jahr wieder einen Fünf-Tages-Kurs für Anfängerinnen, wo man gerne die eigene Maschine mitbringen kann. Das ist total hilfreich, weil jede Maschine etwas eigen ist. Falls man keine hat und erst mit dem Gedanken spielt, sich eine anzuschaffen, kann man sich trotzdem anmelden. Es gibt dort Leihmaschinen und wir können verschiedene Dinge durchprobieren. Ich würde empfehlen, vor dem Kauf einen Kurs zu machen.
Im kommenden Herbst mache ich auch wieder einen Kurs in der GEA Akademie. Das ist ein Wochenendkurs im Waldviertel in Niederösterreich, von Freitag bis Sonntag. Das ist ein bisschen ein Crashkurs – man hat natürlich weniger Zeit, aber es geht um ein Hineinschnuppern in die Materie. Seit ein paar Jahren bin ich auch immer wieder in der Schweiz. Ich hoffe nächstes Jahr auch wieder. Heuer war ich bei Zürcher Stalder.
Gabi (30:24): Die sind in der Nähe von Bern, in Lyssach, glaube ich.
Veronika (30:30): Ja. Zwischendurch mache ich auch einzelne andere Aktionen oder Kurse, wenn sich was ergibt. Aber ich mache keine Einzelstunden oder Nachhilfestunden mehr. Das habe ich mal gemacht, aber das geht sich zeitlich nicht mehr aus.
Gabi (30:45): Wenn jemand sagen würde: „Ich und meine Freundinnen, wir haben ganz viele Strickmaschinen“, könnte man dich als Gruppe oder Verein einladen?
Veronika (30:56): Ja, total gern. Ich überlege schon seit Jahren, weil ich oft darauf angesprochen werde, warum ich alles in Oberösterreich oder Niederösterreich mache und nicht weiter im Westen. Innsbruck wäre vielleicht mal eine Idee, und das würde ich total gern machen, aber es müsste sich jemand finden, der das organisiert.
Gabi (31:18): Sodass du nur als Kursleiterin gebucht wirst und jemand anderer den organisatorischen Kram erledigt.
Veronika (31:25): Genau. Ich kann Maschinen mitbringen. Meine Maschinen sind transportabel. Ich habe bis zu zwei Maschinen schon bis in die Schweiz transportiert. Das geht, aber der Rest – die Organisation – ist einfach aufwendig.
Gabi (31:40): Kursinhalte sind dann, soweit ich gelesen habe: ein bisschen Bindungslehre, eigene Muster entwerfen, die eigene Maschine kennenlernen, was darauf stricken.
Veronika (31:50): Genau. Es hat sich bewährt, dass ich keinen strengen Stundenplan für einen Kurs habe, sondern auf die Gruppe und die individuellen Fragen eingehe. Bei Anfängerinnenkursen wiederholen sich natürlich die Themen: Wie schlägt man an? Welches Garn verwendet man? Wie stellt man die Maschine gut ein? Wie bereitet man das Garn vor? Also diese Anfänger-Dinge. Was mache ich, wenn eine Masche fällt oder wenn ich eine Nadel auswechseln muss?
Wenn dann zusätzliche Fragen kommen – wie Socken stricken oder verschiedene Musterarten – gehe ich gezielt darauf ein. Ich mache immer eine Fragerunde am Anfang: Wer sich für was interessiert, wer schon was kann, und dann passe ich den Kurs entsprechend an.
Gabi (32:48): Socken stricken auf der Flachbettmaschine?
Veronika (32:50): Ja, das machen ganz viele. Ich finde es nicht so lustig, kann mir den Reiz aber vorstellen. Es ist ein relativ komplexes Teil und trotzdem klein genug. Man hat eine schwierige Aufgabenstellung und trotzdem kein zu großes Teil. Wenn man das fertig hat, hat man ein Erfolgserlebnis und ein praktisches Stück.
Gabi (33:13): Socken stricken auf Maschine habe ich bisher nur im Lungau bei Huber Wolle gesehen. Das ist so eine Rundstrickmaschine, die immer im Kreis geht, dann die Ferse hin und her macht und dann wieder im Kreis weiterstrickt. Da habe ich glaube ich sogar mal ein Video auf Instagram gepostet. So eine alte Maschine – wahrscheinlich aus den 40er, 50er Jahren aus England. Socken stricken hätte ich eher auf so etwas gesehen, was wie ein Strickliesel im Kreis strickt, aber auf der Flachbettmaschine ist interessant. Ist das dann eine Doppelbettmaschine, die hin und her strickt?
Veronika (33:52): Je nachdem. Diese Maschinen, die du beschreibst, sind spezialisiert auf Socken. Man kann auch auf einer Flachbettmaschine einen Schlauch machen, indem man zum Beispiel ein Doppelbett dran hat – dann hat man einen flachgedrückten Schlauch, der rauskommt. So kann man sehr gut Socken stricken. Man kann aber auch in einer Fläche einen Socken stricken und hat dann eine Naht, wie früher bei den Nylon-Strümpfen.
Gabi (34:24): Wenn sich jemand dafür interessiert, wie er die alte Strickmaschine wieder in Betrieb nimmt, kann man einfach auf deiner Webseite schauen. Du hast auch einen Online-Kurs, der die Angst davor nehmen soll, Strickstoffe selber zu vernähen. Wenn ich eine Selbernäherin bin, kann ich sowohl Webware als auch Strickware als Meterware kaufen. Viele haben eine gewisse Hemmung, das unter die Nähmaschine zu legen, weil sie befürchten, dass es sich wellt oder ausgedehnt wird.
Veronika (35:08): Das ist ganz interessant aus meinem Werdegang. Ich war in der Textilschule und wir wurden für die großen Maschinen unterrichtet. Da war Meterware das Klassische. Es war klar, dass man die Meterware verkauft und dann daraus etwas geschneidert wird. Als ich meine erste Maschine kaufte, war das auch mein Grundgedanke – dass ich Meterware produziere, auch auf so kleinen Maschinen, und die Leute kaufen das und nähen sich etwas daraus.
Das war ein bisschen Wunschdenken, weil sich herausstellte, dass die Leute sich nicht trauen, hineinzuschneiden. Man ist das vom Handstricken überhaupt nicht gewohnt – bei uns zumindest. Es gibt andere Traditionen, wo das sehr wohl üblich ist. Man lernt viel über die eigene Handstrick-Tradition in dem Geschäft.
Ich gehe gerne Secondhand einkaufen und habe viele ältere Strickteile gesehen. Ich habe beobachtet, wie sie das damals in den 60er, 70er Jahren oft mit einer ganz normalen Geraden- oder Zickzack-Nähmaschine genäht haben. Lustigerweise haben Schneiderinnen weniger Stress, in Strick hineinzuschneiden, aber Strickerinnen denken oft: „Da brauche ich eine Overlockmaschine und das und das und das.“
Dann konzipierte ich diesen Kurs so, dass man das nicht braucht. Mit einigen Hilfsmitteln und vielen Tipps und Tricks kann man sich schöne Dinge aus Strickstoffen schneidern – vielleicht auch aus an der Maschine selbstgestrickten oder aus gekauften Stoffen, zum Beispiel von Anita Pavani, die sehr schöne Strickstoffe haben. Wie man sich die Scheu nimmt und schöne Ergebnisse auf einer ganz normalen Haushaltsnähmaschine erzielt.
Gabi (37:22): Mit einem kleinen Zickzackstich machst du das, glaube ich. Das kann ich bestätigen. Bei Strickstoff bin ich relativ hemmungslos, aber ich habe mir im letzten Winter eine Norwegerjacke gestrickt. Gerade in Norwegen – weil du sagtest, in anderen Stricktraditionen ist das üblich – „steekt“ man, das heißt, man strickt in der Mitte fünf, sechs Maschen einfach glatt und schneidet das zum Schluss auf.
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Strickstück aufgeschnitten. Ich bin eine Strickerin, die sehr oft auftrennt: Ich stricke etwas, dann gefällt es mir nicht mehr, dann trenne ich auf und stricke etwas Neues daraus. Aber wenn ich es einmal zerschnitten habe, ist das nicht mehr möglich. Es war eine große Überwindung aufzuschneiden. Aber als ich es aufgeschnitten hatte und dieses Selbstgestrickte auch als Strickstoff begriff, war es mir plötzlich egal. Dann habe ich auch noch Abnäher hinten und vorne genäht, weil ich zu viel Material im Kreuz hatte [Hohlkreuzanpassung]. Dieses erste Reinschneiden in den Strickstoff war eine Überwindung, aber es hat gut funktioniert, das mit der Maschine zu nähen, obwohl es ein relativ dicker, selbstgestrickter Stoff war.
Veronika (38:42): Man muss es nur mal machen. Man muss sich nur mal drübertrauen.
Gabi (38:45): Und vielleicht braucht man jemanden, der einem das mal zeigt und sagt: „So geht das, mach dir keine Sorgen, das ist keine Hexerei.“ Wo kann ich mehr über dich erfahren?
Veronika (38:57): Über meine Website. Ich bin auch auf Facebook und Instagram.
Gabi (39:06): Man kann auch deinen Newsletter abonnieren, der hin und wieder erscheint, und wo du über Kurse informierst.
Veronika (39:14): Ja, in unregelmäßigen Abständen schicke ich den aus.
Gabi (39:18): Vielen herzlichen Dank. Das war extrem spannend und motiviert mich, meine Strickmaschine wieder auszupacken und etwas zu stricken.
Veronika (39:20): Danke auch. Das freut mich.



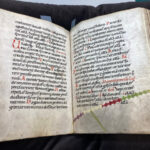


Schreibe einen Kommentar